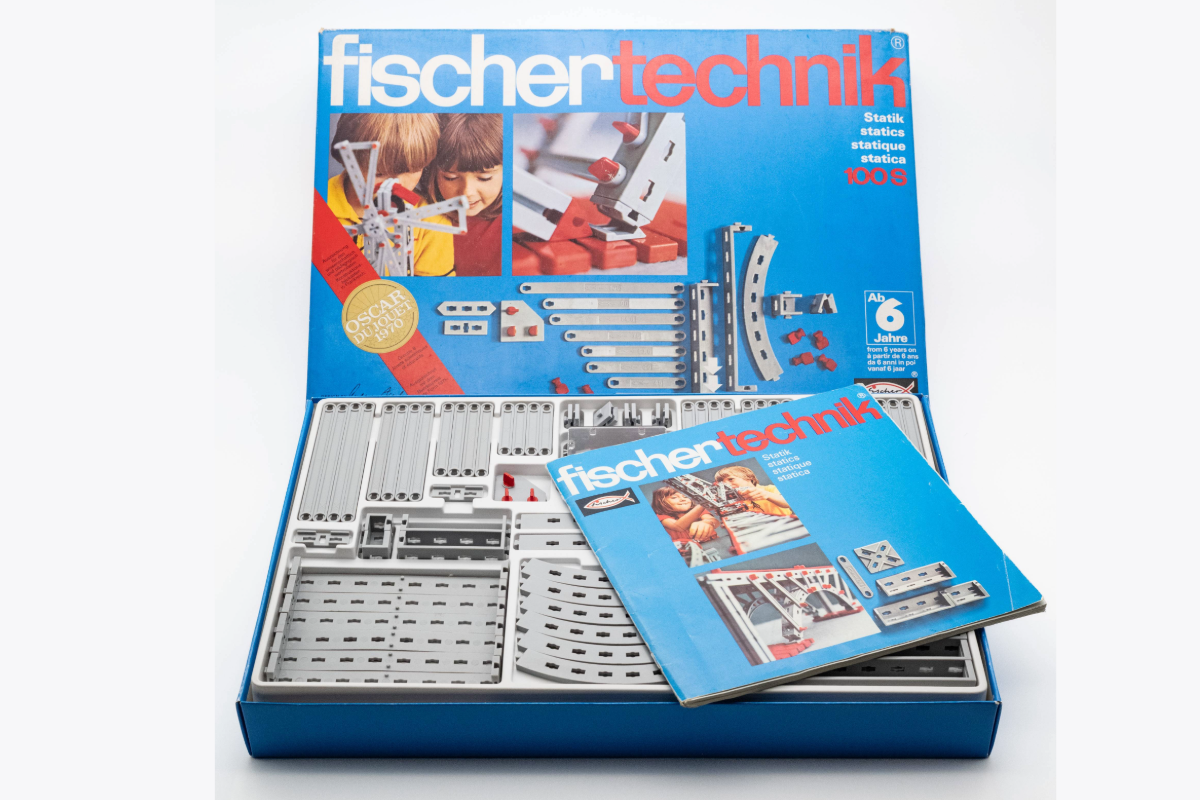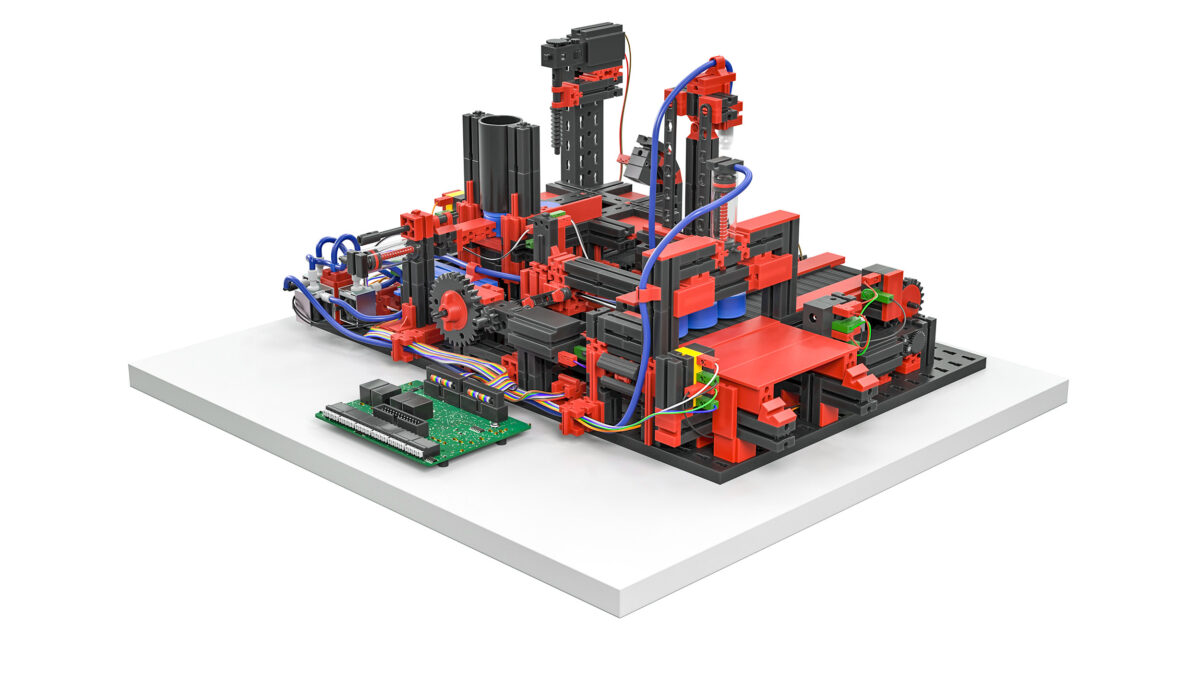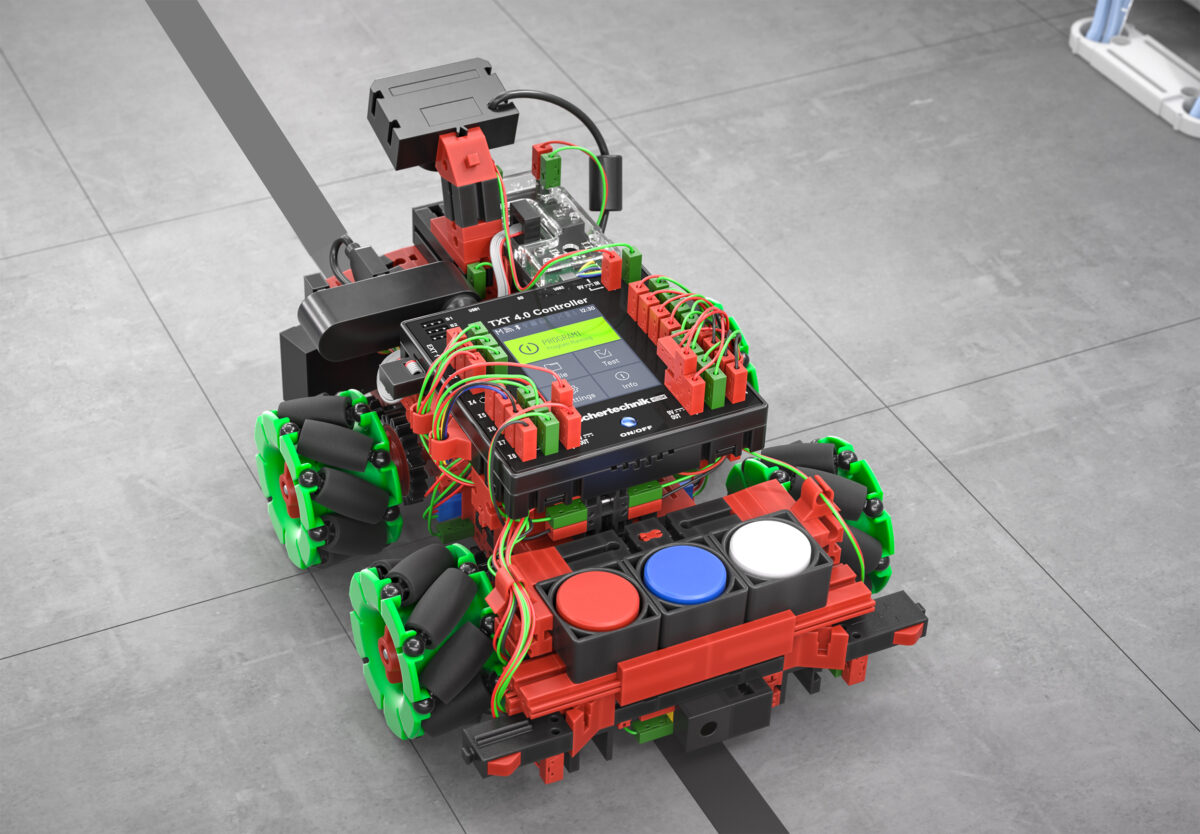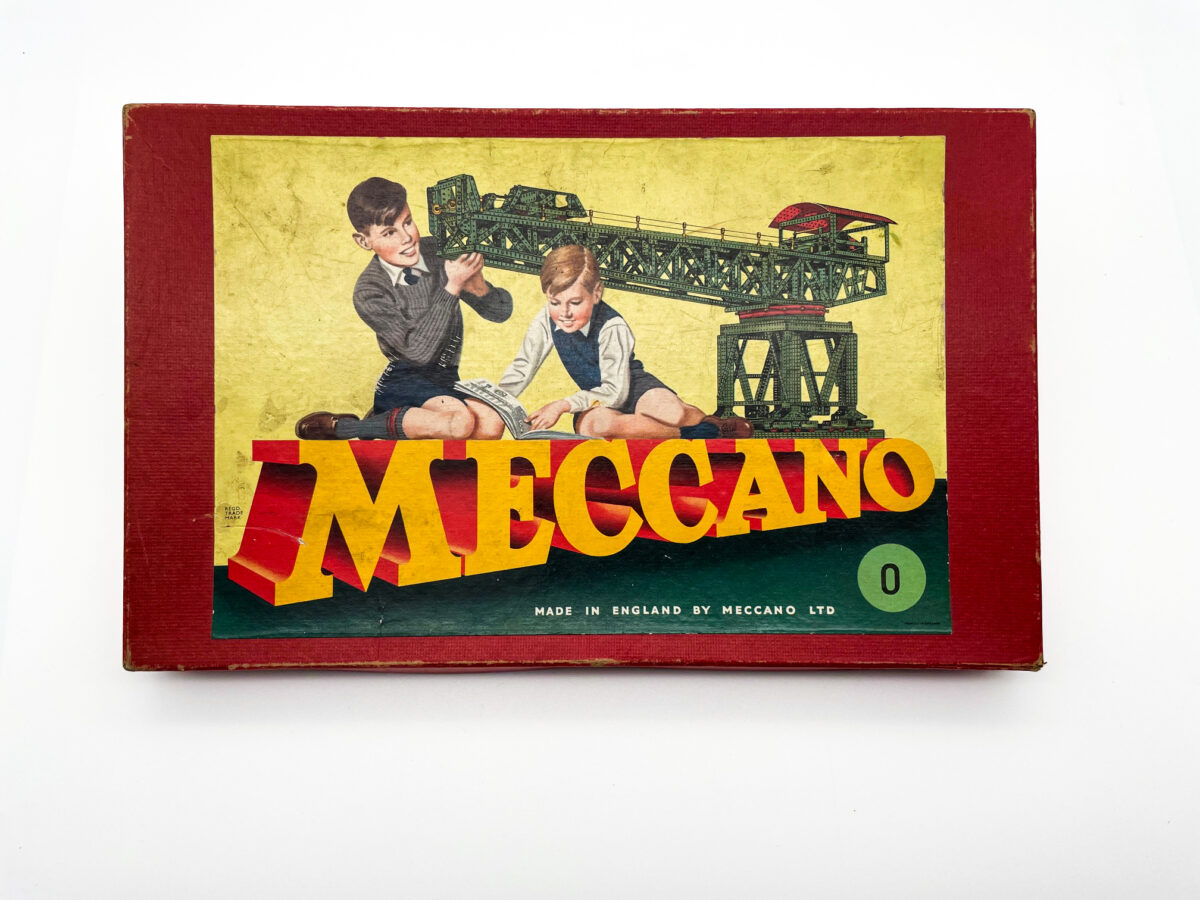- 05. November 2025
- Sicherheit & Praxis
- Peter Thomas
Das Traumauto zum neuen Führerschein
Der Führerschein ist geschafft! Endlich allein unterwegs sein im eigenen Auto. Welches der perfekte Wagen für Fahranfänger ist? Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH hat wichtige Tipps parat rund um die Auswahl des ersten eigenen Autos und den sicheren Umgang damit.

Den Führerschein frisch in der Tasche – und jetzt?
Alles absolviert, alles bestanden: die Fahrstunden, die Theorieprüfung und zum Schluss auch die mit einiger Nervosität erwartete Prüfungsfahrt. Glücklich und stolz hält man den Führerschein in der Hand. Jetzt fehlt nur noch das eigene Auto. Diese sechs GTÜ-Tipps helfen bei der Wahl und den Start ins Leben als Autofahrer.
1 – Sicherheit geht vor – ganz besonders am Anfang
Auch mit der frischen Fahrerlaubnis in der Tasche ist man noch kein erfahrener Profi hinter dem Lenkrad, denn es fehlt Routine. Deshalb ist der wichtigste Punkt bei der Auswahl des ersten eigenen Autos die Sicherheit: Airbags, ABS und ESP sollten zur absolut sinnvollen Grundausstattung gehören, zusätzlich nützlich sind moderne Helfer wie etwa Notbremsassistent und Spurhaltewarner. In kritischen Momenten können solche Assistenzsysteme den Unterschied machen.
2 – Kompakt, aber oho
Bestimmt gibt es einen Traumwagen mit viel Platz oder viel Leistung. Optimal für Fahranfänger ist hingegen ein kleineres Auto mit nicht zu starkem Motor. Das ist günstiger in der Anschaffung und auch beim Fahren entspannter, vor allem in der Stadt und im Ballungsraum: Man findet besser einen Parkplatz und kommt auch im dichten Verkehr leichter zurecht.
3 – Gern ein Auto mit Biografie
Ein Neuwagen dürfte meist zu teuer sein. Wer sich stattdessen für einen jungen Gebrauchten entscheidet, erhält gleich mehrere Vorteile: Die Technik ist auf einem ziemlich aktuellen Stand, der Preis dafür aber deutlich niedriger. Wichtiger Tipp der GTÜ: Bei einem rund drei Jahre alten Gebrauchten lohnt es sich darauf zu achten, dass er bereits die Hauptuntersuchung absolviert hat – seine erste nach der Neuzulassung. Sie beurteilt Verkehrssicherheit und Umweltverhalten des Autos.
4 – Klug gerechnet
Klar, die Anschaffung des ersten eigenen Autos ist mit Begeisterung verbunden. Trotzdem sollte man sich vor dem Kauf die Zeit nehmen, um genau zu rechnen. Und dabei geht nicht nur um die Kaufsumme, sondern auch die laufenden Kosten: Dazu zählen beispielsweise Spritverbrauch, Steuer und Werkstattkosten. Das kann schnell teuer werden, wenn all diese Kostenpunkte im oberen Bereich des Vergleichsfelds liegen. Also am besten verschiedene Modelle vergleichen, Angebote einholen und ein zum Budget passendes Modell wählen.
5 – Pfiffig versichert
Kfz-Versicherungen für Fahranfänger sind relativ teuer, daran kommt man nicht vorbei. Allerdings lässt sich mit kluger Planung auch an dieser Stelle sparen. Tipp der GTÜ: In der Familie nachfragen, ob man in eine bestehende Versicherung mit aufgenommen werden kann oder ob es möglich ist, eine bestehende Schadensfreiheitsklasse zu übernehmen. Das kann Geld sparen – ebenso wie das Zulassen des ersten eigenen Autos als Zweitwagen auf die Eltern.
6 – Verantwortung beginnt mit dem ersten Kilometer
Nun steht das Auto vor der Tür – Glückwunsch! Das bedeutet zugleich Verantwortung: Am besten gewöhnt man sich sofort an einige wichtige Rituale. Dazu gehört, regelmäßig den Reifendruck zu prüfen und die Scheibenreinigungsflüssigkeit aufgefüllt zu halten. Zu Beginn der dunklen Jahreszeit ist ein Lichtcheck Gold wert. Eine wintertaugliche Bereifung sorgt für Sicherheit auf kalten und verschneiten Straßen.
Alles erledigt? Dann darf der Fahrspaß beginnen: mit Verantwortung und einem sicheren, passenden Auto.