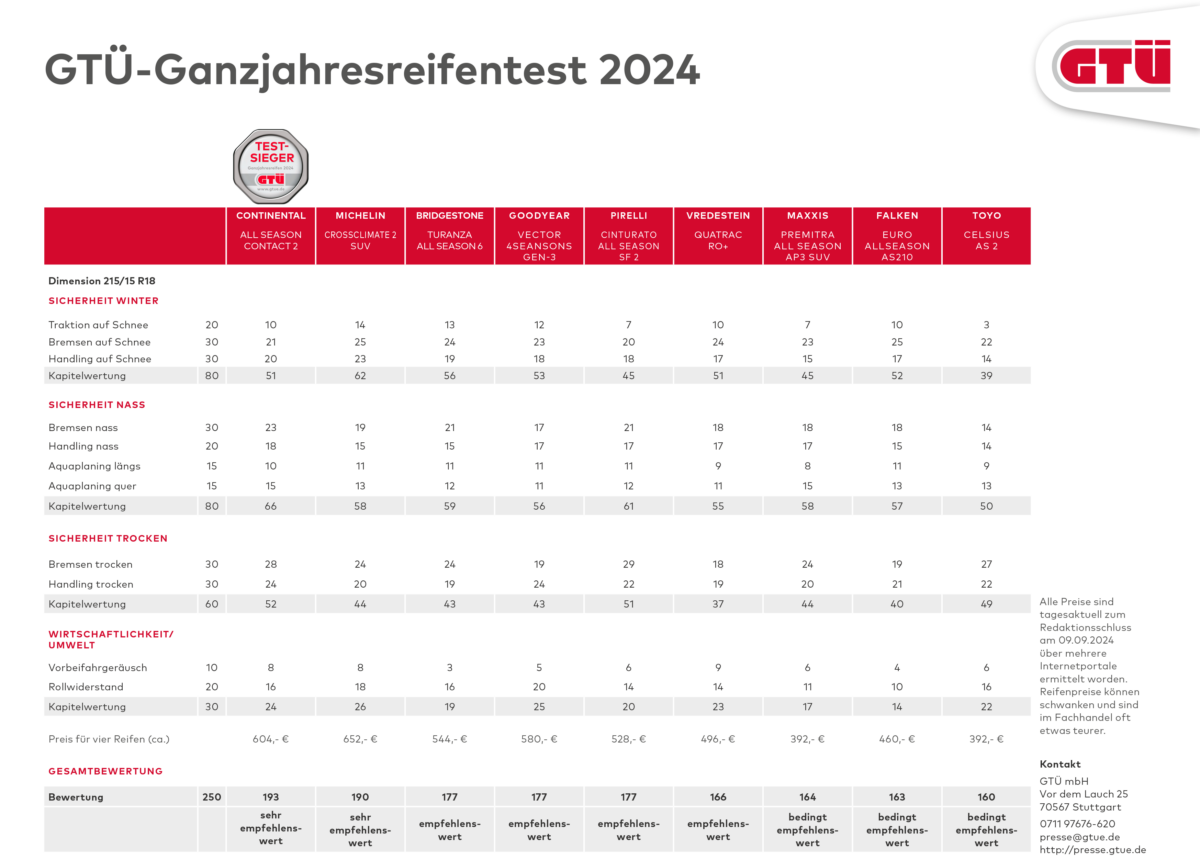- 30. Oktober 2024
- Tradition & Innovation
- Rüdiger Abele
Klassische Fahrzeuge – modernes Wissen
Neue GTÜ-Broschüre „Ratgeber Klassiker“

Lebensart, Leidenschaft und Technik: Das ist die Welt der Oldtimer und Youngtimer auf zwei und vier Rädern. Diese Faszination untermauert die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH mit fundiertem Wissen: Der neue „Ratgeber Klassiker“ ist nicht einfach nur eine Sammlung von Informationen. Sie ist eine Schatzkiste, gefüllt mit 124 Seiten an Wissen, Tipps und Expertenratschlägen und konzipiert im Stil eines einladenden Magazins. Von der genussvollen Ausfahrt mit dem Klassiker bis hin zu Reparatur- und Restaurierungshinweisen bietet der Leitfaden eine umfassende Beratung für alle Facetten des Oldtimer-Hobbys.
Wachsende Begeisterung für historische Fahrzeuge
In Deutschland sind derzeit mehr als 700.000 Pkw im Alter von mehr als 30 Jahren als Oldtimer zugelassen. „Dies verdeutlicht die große Begeisterung für historische Fahrzeuge und ihren Stellenwert. Unsere neue Broschüre zielt darauf ab, dieses Interesse zu fördern und gleichzeitig die Sicherheit dieser Fahrzeuge zu gewährleisten – denn obgleich Oldtimer durchschnittlich nur 3.200 Kilometer pro Jahr zurücklegen, ist ihre Sicherheit unerlässlich“, sagt Thomas Emmert, Geschäftsführer der GTÜ.
Von praktischen Tipps bis hin zu rechtlichen Hinweisen
Der Ratgeber deckt eine breite Themenpalette ab: Beratung zum Fahrzeugimport, Zulassungsverfahren in Deutschland, Erhalt von Patina, Pflege der Originalsubstanz, richtige Reifenauswahl, historisch korrektes Tuning und Umgang mit der Elektronik in Youngtimern sind einige Beispiele. Besonders wertvoll sind die Expertentipps für die Planung und Ausführung von Reparaturen und Restaurierungen sowie Hinweise zur erfolgreichen Hauptuntersuchung und zum richtigen Einlagern der Fahrzeuge, um Standschäden zu vermeiden.
GTÜ: Mehr als nur Hauptuntersuchungen
Die GTÜ ist weit mehr als eine Prüforganisation für die Hauptuntersuchung mit integrierter Abgasuntersuchung. Sie bietet Vollgutachten, Einzelabnahmen und weitere Dienstleistungen an, die den Alltag mit klassischen Fahrzeugen sicherer machen. Für die Fahrzeugzulassung als Oldtimer mit H-Kennzeichen oder für das Fahren mit einem roten 07-Kennzeichen sind Oldtimer-Gutachten der GTÜ-Sachverständigen unerlässlich. Diese Fahrzeuge müssen nicht nur mindestens 30 Jahre alt sein, sondern auch bestimmte Zustandskriterien erfüllen.